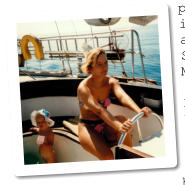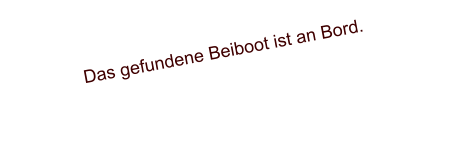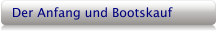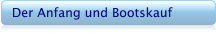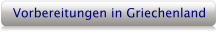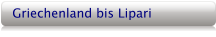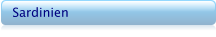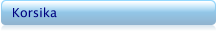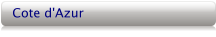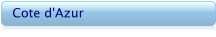Webdesign by A. Graichen © - No copying or reproduction
Impressum und Copyright
Segeln von Griechenland nach Italien
Am Mittwochnachmittag laufen wir endlich aus Nidri aus und mit gemischten Gefühlen sehen wir der kleiner
werdenden Stadt nach. Wir gehen zunächst bei spiegelglatter See um die Südspitze der Insel Levkas herum in
die Bucht von Sivota, in der wir noch die Nacht abwarten und ausschlafen wollen. Der lange, nach Nordwest
biegende Einschnitt der Bucht bietet Schutz nach allen Richtungen und ein neuer Kai mit Restaurants lädt
zum Verweilen. Leicht bewaldete Hügel säumen ringsum die Bucht und lassen den Blick in keine Richtung
offen entgleiten. Besonders interessant sind die Höhlenauswaschungen an der Einfahrt zur Bucht, die man
mit dem Dingi erforschen kann. Bei glasklarem Wasser leuchtet das Sonnenlicht in die niedrige Grotte und
spiegelt eine unwirkliche Unterwasserlandschaft wieder. Leider wird die Schönheit der Bucht durch das
unschöne Bild der Stege und Schiffe einer großen Charterflotte ziemlich verunstaltet.
Zur Feier des Abends lässt sich Petra eine einheimische Languste vom Grill in einem der
Strassenrestaurants schmecken. Wir sind beide ziemlich aufgeregt um die kommenden Ereignisse bei der
Überfahrt nach Italien. Der Wetterbericht spricht von NW 3-4. Also recht gute Bedingungen für die erste
längere Überfahrt.
Wir stehen gegen sieben Uhr auf und frühstücken ausgiebig. Die Nacht hat nur wenig Erholung gebracht, denn
vor Aufregung konnten wir den Morgen kaum erwarten. Nachdem das Boot segelklar ist, laufen wir gegen acht
Uhr aus Sivota Bay aus mit direktem Westkurs. Der Himmel ist stark bewölkt und keine Lüftchen regt sich.
Der Motor schiebt uns in Richtung Italien. Der graue Himmel über uns zwingt mich zum Anlegen der
Regenkleidung und nach etwa einer halben Stunde regnet es wie aus Eimern. Die noch nahe Küste ist im Dunst
nur zu erahnen. Petra und Janine sind bei einem solchen Wetter nicht an Deck zu bekommen und schlafen noch
etwas, während ich eine Dusche nach der anderen abbekomme. „Ein freundlicher Abschied!“, denke ich mir,
während das Wasser in den Regensachen den Rücken runterläuft. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit jetzt
gering, auf ein griechisches Patroullienboot zu treffen. Wir sind nämlich immer noch ohne Transitlog.
Nach etwa drei Stunden sind wir dem Regen entronnen und wir sehen die Wolken nur noch über den hinter uns
liegenden Bergen von Levkas. Der Wind vor dem Regengebiet setzt ein mit etwas Ostluft. Wir setzen alle
Segel und können endlich den Motor ausmachen. Das Boot bewegt sich in der alten Nordwest Dünung reichlich
chaotisch und Petra ist es ziemlich übel. Diesmal probiert sie Ingwerkapseln gegen Seekrankheit aus. Sie
zeigen keine Wirkung, sollen aber immerhin auch keine Nebenwirkungen haben. Wozu dann das Ganze ?
Gegen Mittag taucht ein grauer, kleiner, treibenden Gegenstand am Horizont auf. Beim Näher kommen sehe ich
im Fernglas ein Dingi, ein Gummiboot, ohne jegliches Boot weit und breit. Wir sind inzwischen gut 25
Seemeilen von der Küste Griechenlands entfernt, was den Fund natürlich reichlich unverständlich erscheinen
lässt.
Unter Segeln laufen wir in respektablem Abstand um das Dingi herum. Es treibt umgestülpt mit dem Boden
nach oben auf den Wellen. Wir suchen das Meer nach Leuten oder anderen Schiffen oder Treibgut ab, aber
weit und breit ist Nichts zu sehen. Ich brülle zu dem grauen Gegenstand hinüber, aber Nichts rührt sich.
Wir bergen die Segel und der Motor wird gestartet. Immer noch ängstlich laufen wir um das
Dingi
herum. Die Krise in Albanien und die damit verbundene Flüchtlingswelle hat uns
vorsichtig gemacht. Wir sind selbst auf eine Art Piraterie oder ähnliches gefasst.
Während ich mich um das Dingi und den Wasseraum darum kümmere, soll Petra
aufpassen, ob sich irgendjemand unbemerkt am Schiff hochzieht. Messer, Bootshaken
und ähnliches liegen bereit, obwohl ich nicht genau weiß, was ich damit anfangen
würde.
Mit dem Bootshaken wird das Dingi angehoben, aber auch darunter ist immer noch
niemand zu sehen. Wir befestigen das Schlauchboot an der Besanschot und hieven
es an Bord. Mit eingelaschten Rudern und gebrauchsfertig liegt es nun an Deck
vor uns, geradeso, als hätte es jemand auf den Strand gelegt, um damit später
noch einmal raus zufahren. Die einzige Erklärung für den Fund bleibt ein
Abtreiben bei dem momentan ablandigen Wind, vielleicht durch unzureichendes
Festmachen. Wir demontieren das Schlauchboot in seine Einzelteile und verstauen
alles unter Deck. Die Hülle wird zusammengerollt und an der Reling festgelascht.
Unter Segeln geht es nach einer knappen Stunde weiter. Die Aktivitäten mit dem
Schlauchboot haben Petra die Seekrankheit vergessen lassen, doch so langsam kehrt das
flaue
Gefühl wieder und die Gesichtsfarbe verschwindet zugunsten eines fahlen Weiß.
Gegen Nachmittag müssen wir die Segel dann wieder wegnehmen und laufen unter Motor nach Westen. Der Wind
ist fast vollständig eingeschlafen. Erst gegen Abend kommt er wieder und wir können mit einem leichten NW
um 2-3 gute
Fahrt am Wind machen. Petra geht es ziemlich schlecht, was meine Laune nicht gerade
positiv beeinflusst. Sie liegt fast ständig auf der Koje, denn das ist der Zustand,
in dem sie sich am besten fühlt. Leider muss ich dadurch viel selbst machen und habe
außer Janine recht wenig Unterhaltung. Janine hat keinerlei Probleme mit
Seekrankheit und spielt in Ruhe im Schiff. Bedingt durch die Seeluft schläft sie im
Moment allerdings noch recht viel.
Petra und ich wechseln uns mit der Nachtwache ab. Petra ruht sich meist bis gegen 20
Uhr aus oder schläft, während Janine bei mir im Cockpit ist und spielt. Danach
übernimmt Petra, ich bringe Janine ins Bett und höre den Wetterbericht auf der
deutschen Welle. Morgen ist NW bis N 4-5 angesagt. Anschließend gehe ich etwas
schlafen bis Petra mich weckt, meist gegen Mitternacht. Die Hundewache bleibt an mir
hängen und je nach Tagesform wecke ich Petra erst gegen fünf Uhr morgens. So habe
ich noch etwas Zeit zum Schlafen bis Janine wieder wach wird.
Allerdings fällt es mir in der ersten Nacht ziemlich schwer zu schlafen. Die Pausen sind eigentlich mehr
nur ein Dösen. Zu aufgeregt sind wir beide bei unserer ersten gemeinsamen langen Fahrt mit Beligou und zu
ungewohnt sind die Bewegungen und Geräusche des Schiffes beim Durchpflügen der Wellen.
Die erste Nacht ist gemütlich. Ein gleichmäßiger Nordwest hält uns auf am-Wind-Kurs und ich sitze
angelehnt im Cockpit. Der Walkman gibt unsere neuesten Kassetten wieder, die wir extra für den Törn
aufgenommen haben und der großartige Sternenhimmel lässt hin und wieder eine Sternschnuppe fallen. In
dieser Segellage mit allen drei Segeln gesetzt lässt es Beligou zu, das Ruder von Zeit zu Zeit
festzuklemmen und sich selbst zu steuern. Immer wieder fallen wir dann etwas ab und durch den sich
verstärkenden Druck auf das Besansegeln wird wieder angeluvt, bis der Druck soweit abgenommen hat, dass
das Spiel von vorn beginnen kann. Das gibt mir genug Zeit, um das Ruder zu verlassen und eine heiße Brühe
oder einen Kaffee zu machen.
In dieser Nacht ist überhaupt nichts zu sehen, außer dem weiten schwarzen Horizont und den vielen Sternen
über mir, die zum Greifen nahe scheinen. Nur gelegentlich beleuchte ich den Kompass mit der Taschenlampe
für eine Kurskontrolle. Meist reicht es aus, sich einen Stern oder ein Sternbild zu merken und darauf hin
zu segeln. Kein Positionslicht taucht irgendwo am Horizont auf und bringt etwas Abwechslung.
„Nimm ausreichend warme Sachen mit. Zum Beispiel den Jogginganzug und Sweatshirts werden wir brauchen.“,
hatte ich zu Petra beim Packen gesagt. Die Regensachen und das Ölzeug hatte sie ohnehin nur mit
Widerwillen eingepackt. „Im Sommer ist es dort warm und auch die Nächte sind lau. Das Wasser hat ohnehin
eine angenehme Temperatur. Wir werden schon nicht frieren.“, war ihre Antwort darauf. Und jetzt saßen wir
hier draußen. Ein T-Shirt, erste Jogginghose, zweite Jogginghose, Sweatshirt und 2 Joggingjacken. Der
Lifebelt umhüllte dieses ganze Paket. Meist wurde auch noch die Regenjacke und Regenhose darauf gezogen.
Wir hatten beide nicht für möglich gehalten, wie kalt doch das ruhige Sitzen auf dem Boot bei Nacht sein
kann. Eine heiße Brühe oder Kaffee wurde immer wieder als willkommener Lebensgeist genommen.
Gegen morgen dreht der Wind dann immer mehr auf West und wir müssen auf unserem Kurs immer weiter nach
Südwest bis Süd abdrehen. Dennoch bleiben wir immer noch auf dem alten Bug und machen jetzt mehr Kurs in
Richtung Sizilien als nach Kalabrien. Vielleicht dreht der Wind ja doch wieder auf nördlichere Richtungen.
Ständig ziehen wir die Angel hinter uns her, die Guy an Bord hinterlassen hat. Ich glaube zwar nicht an
einen Erfolg, aber wer weiß. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Die Leine ist auch ausreichend weit weg
vom Schlepplog, sodass keine Gefahr besteht, dass beide sich vertörnen könnten. Gegen Mittag glaube ich
dann, dass wir eine Plastiktüte an der Angel hinter uns her schleifen. Beim näheren Heranziehen erweist es
sich allerdings als ein circa 50 cm langer Thunfisch, der sich bereitwillig bis an die Bordwand ziehen
lässt.
„Warte noch ein bisschen. Hol’ ihn noch nicht rein. Ich mache schnell ein Foto.“ Mit diesen Worten holt
Petra auch schon der Fotoapparat an Deck. Nach 2 Fotos ist allerdings der Film bereits voll. „Kannst Du
schnell nach unten gehen und den Film wechseln. Du weißt doch, dass mir unter Deck schnell schlecht wird.
Ich halte solange deinen Fisch an der Angel.“ Bereitwillig hole ich einen neuen Film, während Petra den
Fisch hält. „Er ist leider abgerissen.“, tönt es mir entgegen, als ich wieder an Deck komme, „Tut mir
leid.“ Damit wäre unser erstes Fischerlebnis erledigt und es gibt wieder nur das zu essen, was wir
gebunkert haben. Ich weiß auch gar nicht genau, ob wir den Fisch wirklich gegessen hätten, oder ob er nach
kurzer Betrachtung wieder im Wasser gelandet wäre. Auf jeden Fall hatte Janine ihre helle Freude an diesem
Erlebnis und noch oft kommt von ihr die Frage, ob wir nicht schon wieder einen Fisch gefangen hätten.
Bedingt durch die Windrichtung wenden wir gegen Abend auf Nordkurs und laufen in den nächsten Stunden gute
50 Seemeilen in Richtung Adria. Der Wind spielt etwas verrückt und nimmt mal zu, mal fast ganz ab. Wir
sind viel mit den Segeln beschäftigt. Das Mittelmeer macht seinem Ruf alle Ehre. Segel bergen, reffen,
ausreffen, Segel setzen usw. usw..
Die zweite Nacht bricht an und die Stimmung an Bord hat einen Tiefpunkt erreicht. Wenn Petra nicht steuert
oder über der Reling hängt, liegt sie in der Koje und erholt sich von ihrer Seekrankheit. Nicht einmal die
leichteste Kost bleibt bei ihr drin, obwohl sie immer wieder versucht, eine Brühe oder einen Keks zu
essen. Die ständige Aufmerksamkeit und Anspannung bringt meine Laune auch nicht gerade in Gang, irgendwie
hatte ich mir den Trip auch anders vorgestellt. Außerdem fordert Janine natürlich auch immer ihr Maß an
Aufmerksamkeit, obwohl es relativ leicht ist, sie mit etwas aus dem Boot zu beschäftigen oder mit einem
mitgebrachten Spiel ihr Interesse für einige Zeit zu fesseln. Insgesamt hält sich Janine ganz super. Sie
spielt viel im Schiff und im Cockpit und ich glaube, sie genießt auch die Zeit mit uns. Ich wüsste gern,
was sie von dieser Fahrt denkt. An Bord hat sie sich bereits gut an den wackeligen Boden gewöhnt und kommt
ohne Mühe auch in das Cockpit geklettert, egal wie schräg das Schiff liegt oder welche Bewegungen gerade
angesagt sind.
ie erste Zeit noch etwas zu kämpfen. Die erste
Standlinie ist nur etwa 1600(!) Seemeilen vom gegissten Ort entfernt. Wir
sind offenbar irgendwo in der Sahara. Das Wasser um mich herum deutet
allerdings stark auf einen Fehler hin. Ich hatte die komplett falsche
Rechentafel benutzt.
Die zweite Standlinie hat nur noch etwa 100 sm Abweichung und nach einiger
Kontrolle entdecke ich auch hier die Fehler. Weniger als 60 sm Abweichung
wollen jedoch einfach nicht zu berechnen sein. Hat unser neues Schlepplog
wirklich eine solche Abweichung oder mache ich in der Astronavigation immer
noch so viele Fehler?
Ich schiebe den Fehler auf die Astroberechnungen und beruhige mich mit dem
Vorhandensein vom Funkpeiler, der bei einem Landfall auf jeden Fall den richtigen Weg weisen wird. Dennoch
bleibt ein flaues Gefühl im Magen, das in der kommenden Nacht noch verstärkt wird. Den Sextant habe ich
immer noch und mache von Zeit zu Zeit mal eine Messung zum Spaß. Im heutigen Zeitalter der GPS Geräte ist
es kaum noch vorstellbar, mit Tafeln und Gestirnen zu messen, aber man braucht auch keinen Strom.
Gegen Abend nimmt der Wind wieder stetig zu und dreht wieder auf Nordwest. Wir nehmen das Besansegel weg
und wenden gegen 21 Uhr wieder auf Kurs West. Der zunehmende Wind fordert ein erstes Reff im Groß und wir
rauschen mit guter Fahrt dem Ziel entgegen.
Als ich gerade halbwegs etwas Schlaf gefunden habe, werde ich um elf Uhr nachts geweckt: „Andreas, wir
haben Blinklichter voraus. Kann das eine Küste sein?“ Wir haben zwar direkten Kurs auf den Stiefelabsatz
Italiens, sind aber nach meiner Koppelrechnung noch gut 100 Seemeilen von Land entfernt. Die Leuchtfeuer
der Küste haben eine Tragweite von etwa 20 Seemeilen und können eigentlich noch gar nicht in Sicht sein.
Aber vor uns sind eindeutig viele weiße blinkende Lichter zu sehen.
Ich versuche mit dem Funkpeiler irgendein Signal der Küstenfunkstellen zu empfangen, aber das Gerät bleibt
komplett ruhig. Nicht mal eine Störung ist zu hören. Dann stellen wir fest, dass ein Blinklicht mit
ziemlicher Geschwindigkeit näher kommt und offenbar auch nur einen kleinen Abstand zum Wasser hat. Wir
fallen schleunigst ab und segeln an der großen Zahl blinkender Lichter entlang, die irgendwo zwischen uns
und dem schwarzen Horizont treiben. Am gesamten Horizont sind nur Blinklichter zu sehen ohne vielleicht
ein Begleitschiff und auch in der Karte oder im Handbuch sind keinerlei Angaben zu finden. Bis heute
wissen wir nicht, worum es sich gehandelt hat. In Diskussionen mit Seglern in den folgenden Hafenstädten
wurden Vorschläge von Fischernetzen bis zu Militärübungsgebieten gemacht. Eine echte, schlüssige Erklärung
hatte allerdings keiner.
Die Wettervorhersage spricht weiterhin von Nordwest 4-5. Hoch am Wind donnern wir durch die Wellen, die
sich bisweilen auf dem Vorschiff brechen. Im Cockpit bekommen wir allerdings nur ein paar Spritzer ab. Der
Bau des Vorschiffs von Beligou fungiert als recht guter Wellenbrecher. Man merkt auch deutlich das Gewicht
von Beligou, wenn es um das Durchschneiden von Wellen geht. Wir liegen immer noch ziemlich ruhig in der
höher werdenden See mit den kurzen Wellen, die so typisch für das Mittelmeer sind.
Trotz ihrer Seekrankheit versucht Petra, sich nicht hängen zu lassen. Ihr geht es zwar ziemlich schlecht,
aber sie versucht trotzdem alles zu machen und zu helfen und in der Bordroutine weiter ohne Unterbrechung
mit zuwirken.
Immer wieder spielen Delphine um das Schiff herum und schauen neugierig nach oben. Janine ist jedes Mal
total aufgeregt und aus dem Häuschen. Petra und Janine stehen an der Reling und klatschen und lachen, was
die Delphine zu immer neuen Kapriolen, Sprüngen und Wettrennen anstachelt. Es ist für uns immer wieder ein
faszinierendes Bild, wenn diese intelligenten Tiere an der Bordwand entlang schwimmen, sich auf die Seite
drehen und ganz offensichtlich versuchen, uns Menschen zu betrachten und wohl heraus zu bekommen, was wir
hier wollen.
Die Navigation scheint auch besser zu werden. Das Mittagsbesteck weißt eine Abweichung von nur 10 sm
zwischen dem gekoppelten und dem berechneten Ort auf. Und das nach immerhin 2 Tagen Koppelrechnung. Auch
die Linie aus der Position des Funkpeilers schneidet diesen Punkt. Wir sind noch 30 Seemeilen vor der
Kalabrischen Küste. Die Annäherung an die Küste fällt auch im Wasser stark auf. Die Zahl der Plastiktüten,
Behälter und sonstiger Müll im Wasser nehmen stark zu.
Am Nachmittag sichten wir die Umrisse der Kalabrischen Küste. Der Wind schläft immer mehr ein und die See
wird Schließlich spiegelglatt. Offenbar liegen wir in Lee der Küste, die nun den Nordwest Wind blockiert,
der uns die ganze Zeit voran gebracht hat. Uns begegnen wieder Fähren und Segelboote, Fischer und
Frachter. Wir bergen alle Segel bis auf das Groß und motoren durch ein glattes Mittelmeer. Endlos lang
dauert es, bis wir der Küste näher kommen und nur langsam wachsen die Berge immer höher aus dem Meer. Die
Stimmung an Bord wird ausgelassen und fröhlich. Das glatte Wasser sorgt für eine schlagartige Besserung
der Seekrankheit von Petra. Sie bereitet ein köstliches Abendessen aus Spaghetti mit Tomatensosse und es
gibt das erste, eiskalte Bier seit zwei Tagen.
Am späten Nachmittag runden wir dann Capo Spartivento am südlichen
Stiefelabsatz von Italien und laufen auf Westkurs nahe an der Kalabrischen
Küste der Strasse von Messina entgegen. Die Kalabrische Küste wirkt wild und
fremdartig, aber dennoch irgendwie sympathisch. Hoch und teilweise grau
ragen die Felsen in den Himmel und verschiedenste zerklüftete Formen von
Gipfeln ziehen an uns vorbei.
Nur noch 15 Seemeilen bis nach Reggio in der Strasse von Messina, der
Meerenge zwischen dem italienischen Stiefel und Sizilien. Wir haben Reggio
als Eingangshafen ausgewählt, um dort alle nötigen Formalitäten zu
erledigen, die Tanks zu füllen und Lebensmittel zu bunkern. Messina auf der
sizilianischen Seite wurde uns aufgrund der unruhigen Liegebedingungen mit
dem starken Fährverkehr nicht empfohlen. Reggio dagegen hat ein eigenes
Hafenbecken nur für Yachten.
Noch 3 Stunden und wir könnten gegen zehn bis elf Uhr im Bett liegen. Die
Aussicht ließ Freude aufkommen und die Erwartung war groß.
Doch bereits in der Nähe des Südeingangs der Strasse von Messina beginnen erste starke Böen das Boot zu
schütteln und uns sagen zu wollen, dass es doch nicht so einfach und schnell gehen wird. Gischt spritzt
über Deck und die Regenkleidung wird dringend nötig. Wir sehen Segelschiff in der Mitte des Fahrwassers
voraus mit ziemlicher Krängung und haben eine erste Vorahnung der bevorstehenden Nacht. Mit dem letzten
Tageslicht runden wir das Leuchtfeuer am Südosteingang der Strasse von Messina.
Der Wind nimmt schnell zu auf 5-6 aus Nord, genau durch die Strasse von Messina und uns entgegen. Die
Meerenge wirkt dabei wie ein Trichter für Wind und Wellen. Uns bleibt also keine andere Wahl als zu
kreuzen. Breit genug ist die Strasse von Messina im Südteil allemal, wenn auch stark frequentiert von
Frachtern.
Frust macht sich unter uns beiden breit, hatten wir doch damit gerechnet, sehr bald schon in der Koje zu
liegen und die Anstrengungen der letzten Tage zu vergessen. Es sieht nach weiterer Arbeit aus und Reggio
ist weiter entfernt als uns lieb ist, obwohl wir zu Fuß wahrscheinlich schnell w„ren.
Inzwischen hängt die Nacht wie ein schwarzer Vorhang vor dem Bergufer von Sizilien. Die Ufer der Strasse
von Messina leiten uns durch ihre Beleuchtung wie auf einer Autobahn. Leider lassen sich in dem
Lichtermeer auch nur sehr schwer die Frachter ausmachen, die hier durch das Fahrwasser ziehen. Immer
wieder wird eine vermeintliche Hafeneinfahrt zum bewegten Objekt, dass die Strasse von Messina befährt.
Ein reger Verkehr von Fähren kreuzt immer wieder quer durch das enge Gewässer und verlangt ein großes Maß
an Aufmerksamkeit. Der starke Verkehr der Fähren scheint nicht einmal in der Nacht abzunehmen.
Das Lichtermeer der nahen Ufer gepaart mit dem regen Schiffsverkehr lässt diese Meerenge irgendwie
unwirklich und faszinierend erscheinen.
Und immer wieder wird ein neuer Schlag von einem Ufer zum anderen fällig. Der Wind rauscht nach wie vor
böig heran. Im Gewirr der Lichter sehen wir dann endlich das rote Blinklicht der Einfahrt. Kurze Zeit
später wird auch grün sichtbar und wir freuen uns, endlich dem Ziel näher zu kommen. Doch nur sehr langsam
wachsen die Lichter auf uns zu, während wir aufkreuzen. Während ich kreuze schläft Petra etwas und nach
etwa 2 Stunden wechseln wir. Erst gegen 3 Uhr nachts lässt der Wind immer mehr nach und das Segeln wird
wieder einfacher.
Ein schemenhafter Turm, den wir neben der Hafeneinfahrt schon länger gesichtet haben, entpuppt sich beim
Näherkommen der Blinklichter als ein recht hoher Strommast.
Erst jetzt fällt der Groschen bei mir. Aus dem Studium der Unterlagen der Strasse von Messina wusste ich,
dass am Nordeingang auf der Seite von Sizilien ein riesiger Strommast steht. Der Vergleich mit der Karte
bestätigt alle Befürchtungen. Wir sind total an Reggio vorbei gesegelt und haben die Lichter des
Nordausgangs der Strasse von Messina für die Hafenfeuer gehalten. Da Reggio der erste Hafen ist, der beim
Befahren der Strasse von Süd nach Nord auftaucht, haben wir es in unserer Freude über den nahen Hafen
total unterlassen, noch einmal in die Seekarte zu schauen. Wir hatten auch überhaupt nicht über Kennung
oder Taktfolge nachgedacht oder mit der Karte verglichen, sondern sind einfach nur drauflos in der Annahme
der bevorstehenden Bettruhe. Anscheinend haben wir mit der Weite des Meeres auch unsere Seemannschaft
hinter uns gelassen.
Wir drehen um und nehmen direkten Kurs auf die vermeintliche Hafeneinfahrt. Es dämmert schon, aber schwach
werden die Lichter der Einfahrt in dem Gewirr der Lichter am Ufer sichtbar. Nach etwa einer weiteren
halben Stunde laufen wir in das ruhige Hafenbecken von Reggio ein. Es ist bereits Morgendämmerung und wir
könnten seit einigen Stunden hier sein und schlafen.
Wir legen uns erst einmal hin und fallen in einen ohnmachtsähnlichen Schlaf.
Der Yachthafen von Reggio bietet, obwohl nicht gerade landschaftlich schön gelegen, allen Komfort an, den
wir nach der Überfahrt brauchten. Wir konnten Diesel tanken, Wasser nachfüllen und das Boot säubern. Aus
den Duschen am Steg kamen Unmengen von Wasser und der Stadtkern mit den Geschäften lag nur etwa zehn
Minuten zu Fuß entfernt.
Unser erster Weg führte uns dann auch in die Stadt in eine Eisdiele. Ein köstliches Rieseneis wurde uns
allen in die Hand gedrückt und im Schatten der Alleebäume geschlemmt. Janine’s Augen leuchteten und die
Mundwinkel reichten vor Freude bis zu den Ohren.
Auf der langen und sonst so belebten Einkaufsstrasse war noch absolute Ruhe in der frühen
Nachmittagssonne. Nur einige Hunde, Katzen und Touristen zogen träge an uns vorüber. Es war Sonntag und
noch dazu heißer Nachmittag, eine Zeit, wo sich sowieso kein Einheimischer auf der Strasse blicken lässt.
In einem schattigen Strassencafe genossen wir unser erstes, eiskaltes Bier in Italien. Noch immer gingen
uns die Gedanken an die letzten Tage auf dem Wasser im Kopf herum und so richtig konnten wir den
Unterschied zwischen dem etwas heruntergekommenen griechischen Dasein und dem hier zu Tage tretenden
italienischen Stil nicht glauben. Die Leute waren zwar nicht reich, aber gut angezogen und zurecht
gemacht. In Italien geht man halt nicht einfach in alter schäbiger Kleidung nach draußen. In den Parks
macht sich auch nicht so die schwere, träge, orientalische Art der Griechen breit. Hier pulsierte das
Leben auch jetzt am Tage schon sehr laut und hektisch.
Als wir dann unser erstes Bier bezahlen wollten, wurden wir auch schlagartig in eine weitere italienische
Wirklichkeit geholt. Die Rechnung wies über zehntausend Lire aus.
„Das sind ja mehr als 15 Mark“, stöhnte Petra.
„Bist Du sicher, dass Du richtig umgerechnet hast? Wir haben schließlich nur zwei Bier und eine Fanta
getrunken.“
„Ja, ungefähr 700 Lire sind eine Mark. Hier kannst Du es sehen.“ Und tatsächlich. Die Umrechnungstabelle
der Bank wies tatsächlich mehr als 15 Mark für die Getränke aus. In Griechenland hatten wir kaum mehr als
ein paar Mark dafür hingelegt.
Alles war unverschämt teuer im Vergleich zu Griechenland. Wir versuchten, das Boot daher so billig wie
möglich auszurüsten. Besonders beim Obst mussten wir Abstriche machen, allerdings weniger bedingt durch
die Preise. Das Angebot in den Supermärkten von Reggio war ziemlich bescheiden und nur wenige frische
Waren erreichten unser Schiff.
Wir beschließen, am Dienstag weiter nach dem nahen Lipari zu segeln. Die Liparischen oder Äolische Inseln
sind vulkanischen Ursprungs und bilden mit den Hauptinsel Lipari ein ganzes Gewirr von Inseln etwa 40
Seemeilen vor der Nordostküste von Sizilien. Zu ihnen gehören unter anderem bekannte Namen, wie Vulcano
und Stromboli, wo heute noch aktive Vulkane tätig sind.
Bedingt durch unsere Reiseroute haben wir allerdings nur wenig Zeit für einen Aufenthalt und beschließen,
zunächst nur die Hauptinsel Lipari mit den drei gut geschützten Häfen anzulaufen. Der Wetterbericht sagt
für das Thyrenische Meer schwache Winde voraus.
Um acht Uhr morgens brechen wir den Anker aus dem Hafengrund von Reggio. Während der ganzen Zeit, die wir
in Reggio verbracht haben, war es entweder windstill oder ein leichter Südwind weht die Strasse von
Messina hinauf. Jetzt, bei unserer Abfahrt, weht eine handige Brise um 4 aus Nord, wir haben also wieder
einmal Gegenwind.
„Ich glaube, wir werden den Gegenwind nie los“, klagt Petra nach dem Auslaufen.
„Wir brauchen nur aus der Strasse von Messina rauskreuzen und können dann am Wind nach Lipari segeln. Das
wird also bestimmt gleich ein toller Segeltag. Vielleicht dreht der Wind auch noch.“, aber viel Hoffnung
habe ich nicht, während ich das sage.
Unter Groß und Genua machen wir die Strecke bis zum Nordausgang der Strasse von Messina in 2 langen
Schlägen. Das Wasser in der Biegung des Nordausganges ist, genau wie im Handbuch beschrieben, sehr seltsam
und etwas furcht erregend. Durch die unterschiedlichen Gezeitenströmungen zwischen dem Norden und Süden
der Strasse von Messina bilden sich im nördlichen Knick, wo die Strasse nach Osten biegt, seltsame Wellen
und Strudel aus, die ich sonst noch nirgendwo gesehen habe.
Kleinere und grössere Strudel bilden sich um das Schiff und manchmal scheint eine unsichtbare Kraft am
Heck zu ziehen und zu drücken. In der Seekarte sind auch drei große Strudel verzeichnet, von denen es
heißt, dass sie bei passender Gezeiten und Strömungslage auch größeren Schiffen gefährlich werden können.
Die Wellen, aufgeworfen durch den Wind und die Strömung, laufen nicht mehr in eine Richtung, sondern
kommen in großen Feldern zusammen, platschen senkrecht hoch und fallen wieder in sich zusammen. Überall
rund um das Boot spritzen kleine Wellen hoch und klatschen wieder in sich zusammen, geradeso, als wollten
viele, kleine Hände nach uns greifen und sich wieder zurückziehen. Das schmatzende Geräusch von hunderten
dieser Wellen um das Boot herum bleibt noch lange im Gedächtnis. Ich kann mir gut vorstellen, dass
Odysseus bei seiner Fahrt an Seeungeheuer glaubte, als er diese Erscheinung sah. Solche unnatürlichen
Begebenheiten versetzen die ohnehin abergläubischen Segler doch in Angst und Schrecken und selbst wir, die
wir wissen, was da passiert und warum, können ein flaues Gefühl im Magen nicht unterdrücken.
Nach zwei Stunden Kreuzen haben wir den Elektromast an der Nordostspitze von Sizilien querab und drehen
auf Kurs 280 direkt auf Lipari zu. Der Wind hat immer mehr nachgelassen, sodass wir auch noch den Besan
setzen können. Doch nach einer halben Stunde schönen Segelns wird der Wind so schwach, dass der Motor mal
wieder herhalten muss. Es wird uns bis nach Lipari schieben, weil kein Windhauch die Wasseroberfläche
kräuselt.
Die Luft ist sehr dunstig und obwohl wir im spitzen Winkel der sizilianischen Küste folgen verschwindet
jeder Umriss bald im Dunst. Von Zeit zu Zeit tauchen die Fähren auf, die Lipari mit dem Festland
verbinden, aber ansonsten ist nichts zu sehen.
Petra erholt sich und liegt faul an Deck in der warmen Sonne. Für Janine habe ich den kleinen Swimmingpool
aus Gummi aufgeblasen, in das Cockpit gestellt und mit Seewasser gefüllt. Mit Eimer, Förmchen und anderem
Spielzeug planscht sie stundenlang im warmen Wasser und motzt lediglich rum, wenn sie alles ausgeschöpft
hat und von mir eine neue Ladung Wasser von außenbords braucht. Wenn sie Wasser haben kann, ist sie
vollkommen glücklich und zufrieden und spielt friedlich vor sich hin.
Gegen 17 Uhr schieben sich dann die ersten Umrisse der Inseln aus dem Dunst über der spiegelglatten See.
Außer einer leichten NE Dünung ist bewegt kein Hauch die See.
An Backbord zeichnet sich die Insel Vulcano mit einer leichten Rauchwolke am Gipfel ab. Der kleine, aber
immer noch tätige Vulkan lässt die schmale Rauchsäule senkrecht in den Himmel wachsen.
Immer größer wächst die Insel Lipari vor uns aus dem blauen Mittelmeer.
Wir laufen bei glatter See in den ziemlich offenen alten Stadthafen neben der hohen Zitadelle ein, den wir
uns als ersten Anlaufpunkt ausgesucht haben. An Steuerbord passieren wir noch die leere zusätzliche
Anlegemole außerhalb der Stadt. Dort könnten wir also auch Unterschlupf finden, wenn der Stadthafen voll
ist.
Freundliche Einheimische deuten uns einen Liegeplatz direkt am Hauptsteg zwischen anderen schon ankernden
Booten an. Wir drehen um den Steg herum, der Anker wird fertig gemacht und ich versuche, Beligou mit dem
Hintern zuerst zwischen die Boote zu bekommen. Vorn rauscht nach dem Fallenlassen des Ankers die Kette mit
lautem Rasseln aus.
Zuerst kommen wir dem rechten Schiff etwas zu nahe, aber mit einiger Motorkraft sind wir schließlich
zwischen den Booten. Langsam schiebe ich Beligou in den Zwischenraum. “Noch etwa 2 Meter“, ruft Petra vom
Heck, wo sie mit Leinen wurfbereit steht.
„Noch ein Stück. Halt.“. Wir haben Beligou einigermaßen zwischen den anderen Seglern mit kräftigem Drücken
und Schieben von den anderen Skippern.
„Ein tolles Anlegemanöver war das aber nicht. Noch dazu in einem Hafen ohne Wind.“, lacht Petra von
achtern. “Es dauert halt etwas, bis man sich an Beligou und ihr Verhalten bei Manövern gewöhnt hat.“, gebe
ich auf dem Weg nach vorn zurück. Mit der elektrischen Ankerwinsch ist es jetzt ein Kinderspiel, das
Schiff nach dem Festmachen nach vorn zu ziehen. Aber die Winsch zieht und zieht und zieht und da taucht
auch schon unser Anker wieder aus dem Wasser.
„So ein Mist. Die Kette hat sich schon wieder einmal im Ankerkasten verhakt und ist nicht frei raus
gerauscht. Wir machen den Zeitanker raus. “Schon zum zweiten Mal muss der Zweitanker herhalten. Die Kette
muss beim Ausrauschen durch ein Rohr laufen und wenn sich am Eingang zwei Glieder falsch drehen, verhakt
sich das ganze unlösbar.
Wir machen den Zweitanker an langer Leine fertig und mit dem Dingi wird er weit ins Hafenbecken gepullt.
An der steifen Ankerleine und den Heckleinen an der Pier liegen wir nun gut und sicher. Der Hauptanker mit
seiner schweren Kette ist leider kaum mit dem Dingi auszubringen.
Jetzt können wir uns auch um die Leute an Land kümmern. Abenteuerliche Gesellen stehen da und schauen und
treu an. Sonnengebrannte, freundliche Gesichter unter Matrosenhütchen oder Strohhut schauen uns in die
Augen.
“Gut fest. Good boat. We help. Good fest“, betonen sie mehrmals.
„Nun gib ihnen schon etwa Geld für die Dienste.“, sage ich zu Petra. Einem kleinen Jungen kann sie gerade
noch ein paar Lire
geben, während die anderen schon wieder mit dem nächsten ankommenden
Schiff
beschäftigt sind. Doch am nächsten Morgen beim Brötchenholen wird mir
eindeutig gezeigt, dass wir für gestern noch nicht gezahlt haben. Ich
will gerade etwas Geld geben, als der Hafenmeister auf seinem Fahrrad
um die Ecke biegt.
Mit einer viel sagenden Geste wird angedeutet: jetzt nicht; der darf
nichts merken. Als ich die Brötchen hole, wartet mein Helfer bereits
hinter einer Ecke und steckt so schnell das Geld weg, das ich mir gar
nicht sicher bin, es ihm gegeben zu haben. Erstaunlicherweise ist der
Hafen ansonsten kostenlos.
Im Gegensatz zu Reggio fühlen wir uns in Lipari wie in einem
Ferienparadies. Nur wenige Segelschiffe liegen an der Kaimauer
unterhalb der hohen alten Festung und selbst bei Überfüllung wären
noch Ausweichmöglichkeiten hinter dem Wellenbrecher nördlich der Stadt
zur Verfügung gewesen. Der Hauptkai hat neben dem kurzen Weg in die Innenstadt
den
Nachteil teilweise erheblichen Schwells, der die Boote immer wieder stark schwanken und
gegeneinander drücken lässt. Der Hafen liegt nach West/Südwest gänzlich offen und die großen
Festlandfähren machen unmittelbar neben den Sportbooten fest. Jedes Anlegemanöver ist dabei natürlich von
einigen Wellen begleitet, die wir hier deutlich spüren, wenn Beligou in den Festmachern ruckt und gegen
die Nachbarboote taumelt.
Für diese Unbequemlichkeiten werden wir mit einer herrlichen Insel belohnt. Der Blick vom Boot schwingt
über die Festung und die bunten Fischerboote zu den weißen alten Häusern am Ufer, die sich kontrastreich
von den aufragenden vulkanischen Hügeln dahinter abheben. Sandstrände mit schwarzem, sonnenheissem
Lavasand laden uns immer wieder zum Schnorcheln und Schwimmen ein. Trotz der Touristenmengen, die von den
Fähren an Land gespült werden, sind die Strände und die Stadt ziemlich leer zu dieser sommerlichen
Jahreszeit. Das bunte Treiben an den Geschäften und Lokalen der langen, verkehrfreien Hauptstrasse
schwemmt uns durch die Innenstadt. Überall kann man die besten Südfrüchte kaufen und hier und da sitzen
bleiben und ein Bier trinken und dem Lokalko-lorit frönen.
Die Preise in den Lokalen unterscheiden sich zwar nicht von Reggio, nur die Umgebung ist schöner. Die
kleineren Läden quellen über von Farben und Gerüchen. Töpfe mit Basilikum und Thymian streicheln die Nase.
Die Hauswände sind dekoriert mit Kaktusfeigen und aufgereihten Paprikaschoten, Buschtomaten und Früchten.
Irgendwo dazwischen ist auch hier und da eine Verkäuferin auszumachen, geduldig auf ihrem Stuhl auf Kunden
wartend.
„Wir wären mal lieber etwas eher aus Reggio aufgebrochen und hierher gekommen. Aber das konnten wir vorher
natürlich nicht wissen.“, bedauert Petra unseren langen Aufenthalt in Reggio.
Die Zeit in Lipari vergeht im Flug mit baden, schnorcheln und bummeln. Langsam müssen wir wieder an die
Weiterfahrt denken.
Unser nächster langer Schlag nach Sardinien liegt vor uns. Wir wollen nicht auf die Südküste der Insel zu
halten, sondern direkt Olbia und die Costa Smeralda im Nordosten ansteuern. Dies spart uns Zeit und
Strecke. Wir wären zwar eher an der Küste von Sardinien, wenn wir die Südküste ansteuern würden, aber der
Weg entlang der Küste nach Norden würde mehr Zeit in Anspruch nehmen.
Dafür nehmen wir jetzt in Kauf, noch einmal 3 Tage unterwegs zu sein.
In Reggio hatte sich Petra mit neuen Medikamenten und Mitteln gegen Seekrankheit einzudecken und so
langsam macht sich auch bei ihr der Aufenthalt an Bord bemerkbar. Wurde sie am Anfang noch schnell
seekrank, so muss jetzt schon etwas mehr Seegang her, um sie aus dem Gleichgewicht zu werfen. Auch geistig
hat sie sich auf eine lange Strecke vorbereitet, was der eigenen Kondition und Motivation viel hilft. Bei
der ersten Überfahrt von Griechenland nach Italien wußte Petra schließlich auch noch nicht so ganz, was
auf sie zukommt. Jetzt hat sie einen längeren Törn hinter sich und kann sich geistig auf die vor uns
liegende Strecke einstellen. Wir reden oft über die hinter uns liegende Strecke und machen uns Gedanken
über den nächsten Teil der Reise, was auch bei der Verarbeitung und Vorbereitung hilft. Nach dem Frust der
ersten Überfahrt sind wir daher sehr guter Dinge und sehen dem nächsten Schlag optimistisch und freudig
entgegen. Das reiche Angebot an Früchten in Lipari hat es uns leicht gemacht, die Stauräume mit Obst und
Gemüse für die nächsten Tage zu füllen. Wasser und Diesel sind ausreichend an Bord und so beschließen wir,
am nächsten Tag gegen Mittag abzulegen. Wir wollen nicht direkt morgens los, sondern ausschlafen, gut
frühstücken und Mittag essen und am Vormittag noch einmal in die Stadt, um etwas Obst zu kaufen.
Vielleicht gehen wir auch noch einmal schwimmen.
Der Wetterbericht spricht von umlaufenden Winden 3-4, abnehmend. Am Donnerstag 11.7. gegen zwölf Uhr
brechen wir dann den Anker aus dem Grund von Lipari und machen uns auf den Weg nach Sardinien.